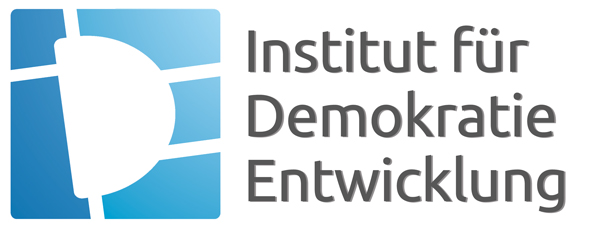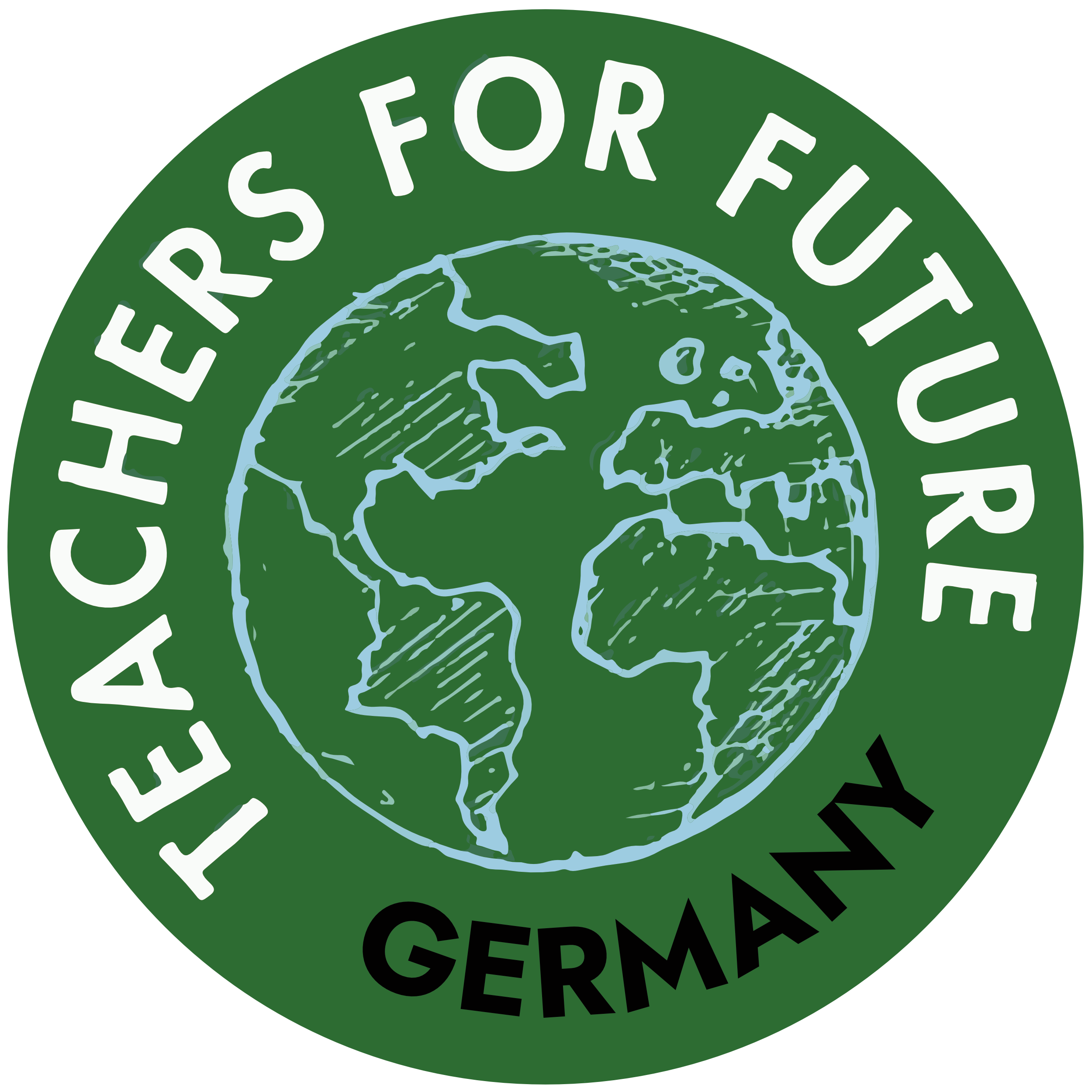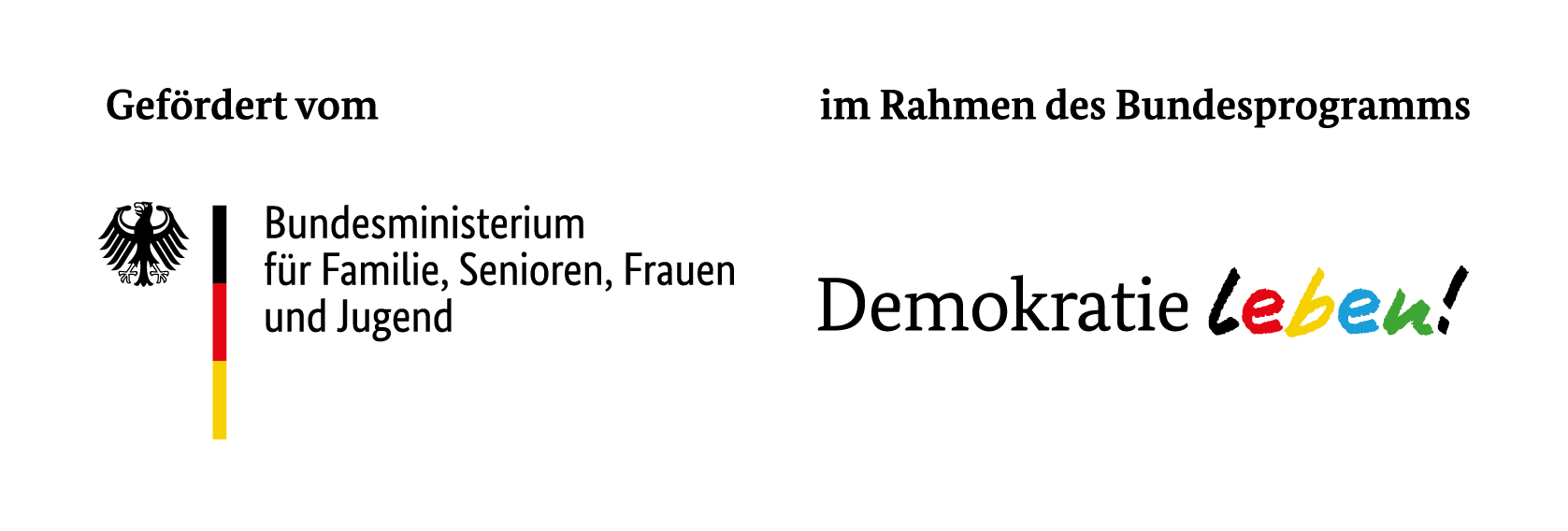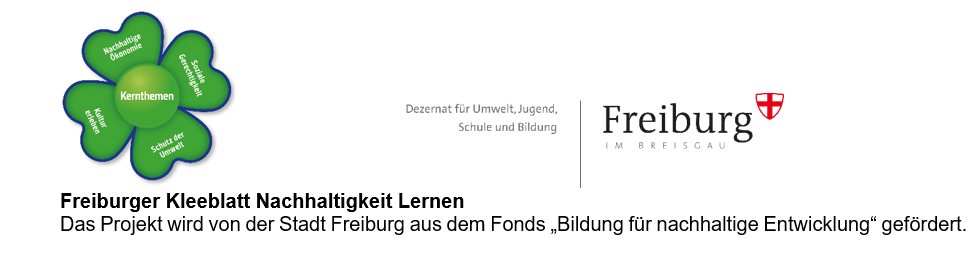Awareness-Konzept
Was verstehen wir unter Awareness?
"Zunächst einmal kommt der Begriff aus dem Englischen ('to be aware') und bedeutet, sich bewusst
sein, sich informieren, für gewisse Problematiken sensibilisiert sein. Es ist ein Konzept, das sich mit
körperlichen, psychischen und persönlichen Grenzen bis hin zu Diskriminierungen auseinandersetzt
und ein Bewusstsein für die bestehenden Macht- und Herrschaftsstrukturen schaffen will.
In unserer Gesellschaft sind gewaltsame Handlungen und Einstellungen tief verankert und
deshalb keine individuellen Einzelfälle. Gewalt, ob sexuell, rassistisch, homophob usw. ist nicht das
Problem eines Einzelnen - sie ist strukturell verankert und gesellschaftlich bedingt." a-team Freiburg
Welche Awareness-Strukturen gibt es in der Weiterbildung?
Um einen Raum zu gewährleisten, in dem sich alle Teilnehmenden wohlfühlen können, arbeiten wir mit dem a-
team Freiburg zusammen, das uns mit Expertise und Erfahrung unterstützt. Wir haben ein Awareness-
Konzept, das auf zwei Ebenen stattfindet. Einerseits bieten wir durch Awareness-Ansprechpersonen und
Angeboten aus dem Kollektiv Unterstützung für von Diskriminierung und (struktureller) Gewalt
betroffene Personen an. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden bilden und sensibilisieren wir uns
kollektivintern in einem Workshop weiter. Andererseits möchten wir die Verantwortung auch in die
Weiterbildungsgruppe geben und dafür die Sensibilisierungsgrundlage mit einem weiteren Workshop für alle
Teilnehmenden während des Einstiegsmoduls legen.
Es ist uns wichtig, dass diese Angebote keine festgesetzten Muster, sondern diskutierbare Einladungen sind.
Anregungen oder Meinungen aus gemeinsamen Reflexionsprozessen sind sehr willkommen. Dadurch können wir
alle zusammen auch während der Weiterbildung am Konzept arbeiten und es an die Bedürfnisse der Gruppe
anpassen.